Programm
Begrüssung | Auditorium
Offizielle Eröffnung der Konferenz durch das Organisationskomitee
Plenarvortrag 1 | Auditorium
Organisierte sexualisierte Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach
Wer sind die Täter und wie sind sie vorgegangen? Wer waren die Opfer?
Die BAO Berg ist eine der größten Einsatzlagen der Kriminalpolizei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bis zum 21.06.2021 konnten 66 Kinder aus den Fängen ihrer Peiniger befreit werden. Bis heute konnten 416 Beschuldigte identifiziert werden. Diese wurden teilweise bereits zu Freiheitsstrafen von bis zu 14 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Diese Einsatzlage richtete, in ihrer Dimension einmalig, zuerst den Blick auf Gefahrenüberhänge und hatte vorrangig das Ziel Kinder zu identifizieren. Dieser Paradigmenwechsel gelang in Zusammenarbeit mit einer zentralen Staatsanwaltschaft, der ZAC NRW bei der Staatsanwaltschaft Köln. Im laufenden Ermittlungsverfahren wurde im LKA NRW zur Reduzierung der Datenmenge von Bild- und Videomaterial ein automatisierter Prozess weiterentwickelt und letztlich auch eine Künstliche Intelligenz eingesetzt. Die eigentlichen Ermittlungserfolge basierten dennoch häufig auf den Auswertungen von Chatnachrichten und dem umfangreichen Einsatz von verdeckten Maßnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität.

Kriminaldirektor Michael Esser
Leiter BAO Berg Polizeipräsidium Köln (D)
Parallel-Veranstaltungen 1
Podiumsdiskussion zum Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach (Plenarvortrag 1) – Lehren für die Schweiz
Raum: Auditorium
Moderierte Podiumsdiskussion mit erfahrenen Experten aufbauend auf der Fallpräsentation des Missbrauchskomplex BAO Berg und welche Lehren zieht die Schweiz daraus?


Kriminaldirektor Michael Esser
Leiter BAO Berg Polizeipräsidium Köln (D)
Die Behandlung komplex traumatisierter Opfer mit EMDR Therapie
Raum: Cobol
Viele der Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt in Kindheit und Erwachsenenalter leiden unter
komplexen
Traumafolgestörungen, die nicht alleine mit den Konzepten zur Behandlung der posttraumatischen
Belastungsstörung
(PTBS) zu behandeln sind.
Ein wichtiger Schritt um die Behandlung dieser Betroffene zu verbessern, ist die neue Diagnose der
komplexen
posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS), die in das neue Diagnosemanual der WHO, die ICD-11,
aufgenommen
worden
ist.
EMDR Therapie ist eine der beiden effektivsten und international anerkannten Behandlungsansätze für die
Behandlung
der posttraumatischen Belastungsstörung die in allen internationalen Behandlungsleitlinien aufgenommen
worden ist.
Auch wenn derzeit nur eine begrenzte Anzahl von kontrollierten Studien zur Behandlung der komplexen PTBS
mit
EMDR
Therapie vorliegt, gibt es doch eine Vielzahl von Fallstudien und klinischen Erfahrungen, die es
ermöglichen
auch
bei diesen Patienten, die häufig in der Praxis nur sehr schwer zu behandeln sind, erfolgreiche
Behandlungen
durchzuführen.
In diesem Vortrag möchte der Referent aus seiner 30-jährigen Behandlungserfahrung einige Grundlagen
erfolgreicher
EMDR Behandlungsstrategien Für diese Patientinnen und Patienten darstellen und an konkreten
Fallbehandlungen
diskutieren.

Dr. Arne Hofmann
Köln
Opferrechte und Verteidigungsinteressen – auf der Suche nach einem tragfähigen Kompromiss
Raum: Fortran
Das geltende Strafprozessrecht sieht in den Art. 152 bis 154 StPO vor, dass Opfer in besonderer Weise geschützt werden sollen. Diese Schutzrechte können die Verteidigungsmöglichkeiten der beschuldigten Person beinträchtigen und stehen insbesondere in einem Spannungsverhältnis zu dem durch die Strafprozessordnung und die Europäische Menschenrechtskonvention gewährleisteten Konfrontationsrecht. Das Referat geht der Frage nach, ob und wie die Opferrechte mit den Verteidigungsinteressen der beschuldigten Person in Einklang gebracht werden können.

Täterprävention – Kein Täter werden – Präventionsarbeit mit Pädosexuellen
Raum: Newton 1011
Kein Täter werden Schweiz hat zum Ziel ein schweizweit einheitliches Therapieangebot für Personen, die sich sexuell zu Kinder hingezogen fühlen, zu schaffen und zu koordinieren. Mit dieser Massnahme sollen sexuelle Übergriffe online wie im reellen Leben verhindert werden und die betroffenen Personen sollen Lernen mit ihrer pädophilen oder hebephilen Neigung deliktfrei zu leben.
Love Limits – Eine interaktive Ausstellung als Eingangstor zur Prävention von sexueller Gewalt unter Jugendlichen
Raum: Newton 1010
Die Ausstellung Love Limits bringt die Prävention von sexualisierter Gewalt an die Schulen. Die Ausstellung und die begleitenden Präventiosangebote setzen Diskussionen in Gang und fördern ein Klima des Hinschauens. Ziel des Workshops ist es, mit den Fachpersonen zu reflektieren, wie Prävention nachhaltig wirken kann. Was braucht es für eine Verankerung der Inhalte bei den Jugendlichen, in der Schule, bei den Eltern und Erziehungsberechtigten? Inwiefern kann die Zusammenarbeit von Schulen, Opferhilfestellen, der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Rahmen des Angebots gestärkt werden? Welche Zusatzmassnahmen müssen umgesetzt werden?
Im Workshop wird die Ausstellung Love Limits vorgestellt.
Die Ausstellung richtet sich an 14-16-jährige Jugendliche der Sekundarstufe I. Love Limits fokussiert
auf
die Themen
Beziehungsgestaltung, sexuelle Grenzverletzungen und (sexuelle) Gewalt unter Jugendlichen.
Das Angebot setzt in der Primärprävention an. Es ist möglich, dass Jugendliche aufgrund von Ereignissen
oder
Gesprächen im Rahmen der Ausstellung Bemerkungen machen oder Reaktionen zeigen, die darauf hinweisen,
dass
sie
selbst Opfer von (sexueller) Gewalt sein könnten. Wie im Falle eines Verdachts vorgegangen wird, ist
Gegenstand
eines definierten Vorgehens im Rahmen des Angebots.
Die rechtsmedizinische Sprechstunde – Leistungen, Anforderungen, Herausforderungen
Raum: Newton 1012
Die rechtsmedizinische Sprechstunde, so wie sie in Kanton Waadt seit bald 15 Jahren praktiziert wird, bietet für die Opfer von Gewalt eindeutige Vorteile. Rechtsmedizinische Leistungen sollten allen Gewaltopfern niederschwellig zur Verfügung stehen und nicht an eine Strafuntersuchung gebunden sein müssen. Der niederschwellige Zugang kann nur gelingen, wenn das Angebot für die Opfer unentgeltlich und vertraulich ist. Es stehen heutzutage vermehrt speziell durch ein CAS oder Nachdiplomkurs geschulte Pflegefachleute zur Verfügung, welche eine solche Leistung erst ermöglichen. Die Pflegefachkräfte bringen spezifische Kenntnisse mit, die in der ganzheitlichen Erstbehandlung von Gewaltopfern klare Vorteile bietet. Auch ist das Gesundheitssystem bestens Vernetzt und absolut bereit, forensische Frontarbeit zu erbringen. Die Grenzen zwischen der Dokumentation uns Spurensicherung und der gutachterlichen fachärztlichen Tätigkeit muss jedoch klar gezogen werden. Auch muss diese Tätigkeit fachlich durch eine rechtsmedizinische Institution begleitet werden, um eine genügende Supervision und Fortbildung zu garantieren. In diesem Vortag, sollen die Vorteile einer rechtsmedizinischen Sprechstunde gezeigt und die konkreten Probleme beim Aufbau und Betrieb dargelegt werden. Das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure soll – auch kritisch – beleuchtet werden.

Trauma, Partnerschaft und Sexualität: Die Sehnsucht nach Beziehung zu sich und anderen
Raum: Newton 1008
Die Sehnsucht nach erfüllender Beziehung, Nähe und Sexualität bleibt für viele Betroffene von Traumafolgestörungen lange Zeit ungestillt. Auch innerhalb der therapeut.-berat. Beziehung wird das Thema nicht selten zunächst stillschweigend zum Randthema erklärt, nach hinten verschoben, bis es schleichend ins Vergessen gerät. Dies kann mit posttr. Vermeidung und Störung der Selbstorganisation bei den Betroffenen, jedoch häufig auch mit gesellschaftlicher Tabuisierung und Unsicherheiten bei uns TherapeutInnen/BeraterInnen zu tun haben. Wenn wir uns jedoch bewusstmachen, was es bedeutet, längerfristig beinahe berührungslos durch die Welt zu gehen, wird deutlich, dass es für Betroffene nicht nur um reinen Lustgewinn geht, sondern vor allem um Kontakt zu sich und zu anderen. Berührung durch sich selbst oder andere nicht als sicheren Hafen, sondern als Auslöser für Intrusionen, Anspannung, Angst, Aggression, Ekel, Schmerz, Scham, Schuldgefühle, Selbstabwertung, Ohnmacht oder Dissoziation zu erleben, verändert jede Form von Beziehungsgestaltung. Die drohende Aktivierung von unsicheren oder desorganisierten Bindungsmustern führt bei vielen zu Rückzug, Vereinsamung und Resignation. Andere ertragen gerade Verlassenheitsgefühle kaum und erdulden stattdessen triggernden Körperkontakt und Sexualität, um nicht allein sein zu müssen (zB dysfunkt. Beziehungen, Promiskuität, Prostitution). Oftmals ist die Erinnerung daran erneut nur bruchstückhaft, hinterlässt innere Aufruhr und noch mehr Verunsicherung. Eigene Bedürfnisse hinsichtlich Nähe, Körperkontakt und Sexualität wahrzunehmen, zu verbalisieren und zu leben, gelingt vielen Betroffenen nur sehr bedingt. Nicht wenige lassen erneute Grenzüberschreitungen alltäglich zu, womit das heilsame Empfinden von Sicherheit und echter Nähe in Beziehungen unerreichbar bleibt und sich schlimmstenfalls Retraumatisierungen ereignen. Wie kann es uns also gelingen, Betroffene auch beim häufig tabuisierten Thema Nähe und Sexualität offen und wertschätzend zu mehr Selbstfürsorge und Selbstbestimmung zu begleiten? Ziel des Vortrages ist es, für das Thema und seine breitgefächerten Auswirkungen zu sensibilisieren. Weiters soll ein Einblick in traumaassoziierte Veränderungen der Körper- und Bedürfniswahrnehmung, traumasensible Sexualanamnese, ressourcen-fokussierte Interventionen aus Körper-, Kreativ- und Paartherapie, sowie je nach Bindungsstil typischerweise anzutreffende Paardynamiken ermöglicht werden.

Dr. med. Marion Mohnroth
Fachärztin Psychiatrie FMH und
Fachpsychotherapeutin f. spezielle Psychotraumatherapie DeGPT,
zertif. med. Gutachterin SIM
Rheintalpraxis-Mohnroth
Parallel-Veranstaltungen 2
Multiple Persönlichkeit - Dissoziative Identitätsstörung, gibt es das überhaupt?
Dissoziative
Störungen zwischen Mythen und wissenschaftlicher Realität
Raum: Auditorium
Die Diskussion über schwere dissoziative Störungen ist seit den ersten systematischen Beschreibungen im 19. Jahrhundert geprägt von heftigen Kontroversen. Erst in der neuen Version des ICD11 von 2019 werden die von Kritikern regelmässig erwähnten Zweifel an diesen Störungen (sie seien soziokulturell oder iatrogen durch Suggestion bedingt) nicht mehr erwähnt. Im Zentrum der Kontroverse steht meist der Zusammenhang dieser komplexen Störungen mit schweren, frühen Traumatisierungen.
Die Kontroverse hat in der Fachwelt zu einem breiten Spektrum an Reaktionen geführt. Neben der Bereitschaft sich vertieft damit auseinander zu setzen gibt es immer noch grosse Verunsicherung und Ignoranz. Mit häufig schwerwiegenden Konsequenzen für die Betroffenen. Wegen fehlender korrekter Diagnostik kommt es nicht selten zu jahrzehntelangen Fehlbehandlungen. Auch werden schwere dissoziative Störungen in der Ausbildung von medizinischen und psychiatrischen Fachkräften immer noch vernachlässigt und in Medienberichten werden weiterhin wissenschaftlich längst widerlegte Ansichten verbreitet.
Im Vortrag, der sich an alle Interessierte richtet, wird die dissoziative Identitätsstörung gemäss Definition der WHO von 2019 vorgestellt und mit einem Videobeispiel aus der Praxis veranschaulicht. Die Argumente der Kontroverse zur dissoziativen Identitätsstörung werden auf dem Hintergrund des aktuellen Standes der Forschung durchleuchtet. Was sind wissenschaftliche Erkenntnisse, was sind Mythen zum Störungsbild? Wie können schwere dissoziative Störungen mit einem strukturellen Modell erklärt werden? Auf mögliche Implikationen für Therapie, Begutachtung, Strafverfolgungsbehörden und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden wird übersichtsmässig eingegangen.

Die neue, unabhängige Meldestelle gegen Pädokriminalität im Netz und die politischen und rechtlichen Hintergründe in der Bekämpfung von organisierter sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen
Raum: Cobol
Der Workshop knüpft am Plenarvortrag 1 von Herrn Michael Esser zur organisierten sexualisierten Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach an und zeigt auf, welche rechtlichen und politischen Möglichkeiten auf nationaler Ebene bestehen, um der (organisierten) sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zu begegnen. Aktuelle politische Forderungen werden eingeordnet und jüngere Entwicklungen (etwa die Änderungen an Strafprozessordnung und Sexualstrafrecht) aufgezeigt. Es wird dargelegt, welche Chancen und Risiken es bei der Umsetzung gibt und wo der dringendste Nachholbedarf besteht. Anschliessend werden Ziele, Angebot und Funktionsweise der neuen, privaten «Meldestelle gegen Pädokriminalität im Netz» vorgestellt. Sie ist ein Beispiel für zivilgesellschaftliche Bemühungen, im vorhandenen rechtlichen und politischen Umfeld zum Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt beizutragen. Nicht zuletzt bietet der Workshop den Teilnehmenden auch die Möglichkeit, in einer Diskussions- und Austauschrunde die Meldestelle oder die rechtlichen und politischen Aspekte zu diskutieren.

Niklaus Bieri
Leiter Politik und Public Affairs
Kinderschutz Schweiz

Liliane Minder
Projektleiterin Meldestelle
Kinderschutz Schweiz

Kinderaussagen im Strafverfahren – Lüge, Phantasie, Wahrheit?
Raum: Fortran
Die Aussagen von kindlichen Zeuginnen und Zeugen sind im Rahmen von Strafprozessen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oft besonders wichtige Indizien. Deshalb ist die Befragung von kindlichen Zeuginnen und Zeugen zentral, auch im Hinblick auf eine allfällige Glaubhaftigkeitsbegutachtung. Die Methodik und die Prozeduren der Glaubhaftigkeitsbegutachtung werden in diesem Workshop dargestellt und in Bezug zur Befragung von kindlichen Zeuginnen und Zeugen gestellt. Daraus werden an praktischen Beispielen im Sinne einer best practice does und donts abgeleitet und gemeinsam weiterentwickelt.
Das erwachsene Opfer im polizeilichen Ermittlungsverfahren
Raum: Newton 1011
Anhand von Beispielen wird aufgezeigt, wie erwachsene Opfer ein Strafverfahren auslösen können. Dabei wird darauf eingegangen auf was vor allem am Anfang geachtet werden muss, um z.B. Retraumatisierungen zu vermeiden und trotzdem möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen, ohne das Opfer zusätzlich zu belasten. Anschliessend werden die weiteren Schritte im polizeilichen Strafverfahren (bis zur Übergabe an die Staatsanwaltschaft) diskutiert und die diversen Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf die gesetzlichen Vorgaben, weitere Beteiligten etc. beleuchtet und besprochen.

Gibt es der Genugtuung genug? Möglichkeiten und Grenzen von Genugtuungsansprüchen
Raum: Newton 1010
Das Referat thematisiert die rechtlichen Grundlagen des Genugtuungsanspruch und geht der Frage nach, inwieweit sich der opferhilferechtliche Genugtuungsanspruch vom deliktsrechtlichen Genugtuungsanspruch unterscheidet und ob die Opfer von Gewalttaten genug, zu viel oder zu wenig Genugtuung erhalten. In einem ersten Teil werden die allgemeinen Voraussetzungen des deliktsrechtlichen Genugtuungsanspruchs erläutert. Im zweiten Teil geht der Referent auf die Anspruchsvoraussetzungen des opferhilferechtlichen Genugtuungsanspruchs ein und erläutert Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Genugtuungsansprüchen, insbesondere was die Anspruchsgrundlagen, die Berechnungsmodalitäten und die Geltendmachung betrifft. Abgerundet werden die theoretischen Ausführungen mit einem Genugtuungsquiz, anlässlich welchen die Teilnehmer Gelegenheit erhalten, sich anhand von konkreten Fällen Gedanken darüber zu machen, welches der angemessene Genugtuungsbetrag wäre und inwieweit sich ihre Auffassung von derjenigen der Gerichte und Behörden unterscheidet.
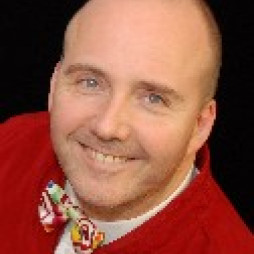
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.
Titularprofessor und Lehrbeauftragter
an der Universität St. Gallen für Privat- und
Sozialversicherungsrecht sowie Haftpflichtrecht
Wissenschaftlicher Konsulent des Instituts für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG)
der Universität St. Gallen
Rechtsanwalt und Notar in Glarus
Umgang mit akuter Suizidalität und selbstschädigendem Verhalten im ambulanten Setting
Raum: Newton 1008
Traumatisierte PatientInnen haben sehr häufig, manchmal schon seit früher Kindheit, Suizidgedanken. Die
chronischen
Suizidgedanken sind oftmals im Hintergrund, manchmal sogar vollständig weg. Es reichen jedoch wenige
innere
oder
äussere Auslöser und die Suizidgedanken werden präsenter. Je nach Situation können die Suizidgedanken
sehr
schnell,
sehr drängend werden. Auch das selbstschädigende Verhalten kann stark zunehmen. Im ambulanten Rahmen
kann es
für
den/die TherapeutIn herausfordernd sein, Patienten mit akuter Suizidalität und schwer selbstschädigenden
Verhalten
ambulant weiter zu behandeln. Ein Aufenthalt auf Akutstation forciert oftmals Suizidgedanken und die
Schwere
der
Suizidversuche und/oder Selbstverletzungen werden innerhalb weniger Tage schlimmer aufgrund der vielen
Trigger auf
Akutstationen. Daher sollte eine Einweisung auf eine Akutstation mit Bedacht erfolgen.
In dem Workshop wird anhand von Fallbeispielen die Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung von akuter
Suizidalität
und schwerem selbstschädigenden Verhalten im ambulanten Setting diskutiert, vor dem Hintergrund
Einweisungen
auf
eine Akutstation möglichst zu vermeiden. Gerne können auch eigene Fallbeispiel eingebracht werden.

Plenarvortrag 2 | Auditorium
Neue Ansätze der Begutachtung: interdisziplinäre Opfergutachten mit Aussagepsychologie & Psychotraumatologie
Die Prüfung der Aussagen der mutmasslichen Opfer auf deren Glaubwürdigkeit/Glaubhaftigkeit hin stellt eine der
zentralen Herausforderungen in einem Strafprozess dar.
Dies insbesondere in Sexualdelikten, bei denen oftmals mangels Zeugen Aussage gegen Aussage steht, was die
Beweisführung schwierig macht. Mittels Einholens eines aussagepsychologischen Gutachtens können Gerichte und
Staatsanwaltschaften den realen Erlebnishintergrund von Opferaussagen überprüfen lassen. Die aussagepsychologischen
Experten wiederum sehen sich häufig damit konfrontiert, dass die Aussagen insbesondere von Sexualstrafopfern
widersprüchlich, unvollständig oder infolge auffälliger Verhaltensweisen in den Einvernahmen unglaubhaft erscheinen.
Eine zusätzliche psychotraumatologische Untersuchung der Opfer erlaubt es besser zu beurteilen, in welchem Ausmass
solche Auffälligkeiten Folge eines fehlenden Erlebnishintergrundes der Tatschilderung oder einer psychiatrischen
Symptomatik wie z.B. dissoziativ bedingter Gedächtnisschwierigkeiten sind.
Eine solch kombinierte aussagepsychologische-psychotraumatologische Begutachtung hat das Potential, die Beweiskraft eines aussagepsychologischen Gutachtens substanziell zu erweitern.


lic. phil. Monika Egli-Alge
Fachpsychologin Psychotherapie FSP,
Zertifizierte Gutachterin SGRP,
Rechtspsychologie FSP
Leiterin Forio AG

PD Dr. med. Christoph Müller-Pfeiffer
Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätsspital Zürich, Medical Thinking Systems
Parallel-Veranstaltungen 3
Interdisziplinäre Opfergutachten mit Aussagepsychologie & Psychotraumatologie: Sinn oder Unsinn?
Raum: Auditorium
Die Gerichte sind im Rahmen eines Strafprozesses immer wieder mit der Aufgabe konfrontiert, die Aussagen eines Opfers auf deren Glaubhaftigkeit hin zu überprüfen. Die Diskussionsteilnehmenden sprechen darüber, wie eine solche Beurteilung in der Praxis vorgenommen wird und welche Schwierigkeiten sich dabei stellen. Dabei geht es insbesondere um die Frage, welche Chancen und Risiken Gutachten über Opferaussagen mit sich bringen.


Dr.iur. Tom Frischknecht
Richter
Kreisgericht St. Gallen

lic. iur. Eveline Roos
Rechtsanwältin
Gressly Rechtsanwälte, Solothurn

PD Dr. med. Christoph Müller-Pfeiffer
Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätsspital Zürich, Medical Thinking Systems


Missbrauchte Liebe - die Loverboy-Masche
Raum: Cobol
Bei der sogenannten Loverboy-Methode versuchen Männer insbesondere junge Frauen in eine fingierte Liebesbeziehung zu verstricken und sie emotional von sich abhängig zu machen, um sie der Prostitution zuzuführen und sexuell bzw. finanziell auszubeuten. Anhand eines aktuellen Fallbeispiels wird insbes. aufgezeigt, wie die Täter dabei konkret vorgehen, was die Risikofaktoren sind, zum Opfer eines Loverboys zu werden und welche physischen und psychischen Auswirkungen bei den Geschädigten zu erwarten sind. Zudem erfolgt eine Einordnung bzw. Würdigung des Phänomens in strafrechtlicher Hinsicht.

Jan Gutzwiller
Leitender Staatsanwalt
Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn,
Abteilung für Wirtschaftsdelikte
und Organisierte
Kriminalität
(WOK)
Minderjährige Opfer im Strafverfahren
Raum: Fortran
Anhand von Beispielen wird erklärt, welche Rechte einem minderjährigen Opfer (0-18 Jahren) in einem Strafverfahren zustehen, wie diese wahrgenommen und optimiert werden können. Die einzelnen Verfahrensschritte vom Erstgespräch bis zum Abschluss des Strafverfahrens werden aufgezeigt und diskutiert. Zudem wird die Aufgaben der am Strafverfahren beteiligten Fachpersonen, speziell die Rolle der Kindesverfahrensvertretung, beleuchtet.

Opfer, Überlebende, Vorbilder. Wege aus der Opferrolle.
Raum: Newton 1011
Woran denken wir, wenn wir den Begriff ‘Opfer’ lesen und hören? Worüber sprechen wir, wenn wir ‘Opfer’ sagen? Die Bezeichnung “Du ‘Opfer’!” gilt in manchen Kreisen als Schimpfwort. Dies macht es Betroffenen schwer, sich selbst als Opfer zu sehen. Vielmehr verstehen sie sich als Überlebende einer schrecklichen Situation. Einzelne werden berühmt, schreiben Bücher über die erlittene Gewalt und werden zu Talk Shows eingeladen. Sie werden zu Vorbildern auf der Suche nach Bewältigungsstrategien im Umgang mit traumatischen Lebensereignissen.
Im Vortrag soll geklärt werden, mit welchen unausgesprochenen Erwartungen das Opfersein verbunden ist. Wie gehen Betroffene und Fachleute damit um? Was nehmen wir Fachpersonen wahr, wenn wir einem ‘Opfer’ persönlich begegnen – und was blenden wir aus?
Geschlechtsspezifische, soziale und kulturelle Aspekte der Opferrolle werden analysiert und deren mögliche Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit und das Selbstverständnis von Opfern reflektiert. Im Kampf gegen das Verharren in der Kategorie ‘Opfer’ gilt es beispielsweise, die mehrgenerationale Weitergabe von Gewaltmustern zu überwinden.

Miko Iso, M.A.
Genderwissenschafterin
Institutionelle Prävention in einem defizitären System - am Beispiel der katholischen Kirche
Raum: Newton 1010
Sexuelle Ausbeutung in der katholischen Kirche ist systembedingt, es handelt sich nicht um Einzelfälle. Sowohl in Bezug auf Haltungen (z.B. Sexualmoral, Unantastbarkeit von Autorität, Definitionsmacht) wie auch auf Strukturen (z.B. Machtpositionen ohne Checks and Balances, Lücken in der Qualitätssicherung, Befangenheit in Melde- und Krisenmanagement) bestehen erhebliche Risiken im System Kirche. Der Workshop beleuchtet diese institutionellen Schwachstellen und leitet Konsequenzen und Learnings für die systemische Prävention ab. Die Ein- und Ausblicke werden kombiniert mit kritischen Perspektiven aus Betroffenensicht auf das System Kirche.

Karin Iten
Fachgremium "Sexuelle Übergriffe
im kirchlichen Umfeld" der SBK

Dr. Stefan Loppacher
Fachgremium "Sexuelle Übergriffe
im kirchlichen Umfeld" der SBK
Die Opferhilfe – Möglichkeiten und Grenzen
Raum: Newton 1012
Die Opferhilfe bietet Unterstützung für Opfer von Gewalttaten. Massgebend ist das entsprechende Bundesgesetz. Es braucht keine Strafanzeige und kein Strafverfahren, um Anspruch auf Opferhilfeleistungen zu haben, dennoch muss eine Straftat (Gewalttat im Sinne des Schweizerischen Strafgesetzbuches) nachgewiesen sein. Die Behörden müssen anhand der vorhandenen Akten prüfen, ob diese Voraussetzung erfüllt ist und verlangen deshalb von der gesuchstellenden Person detaillierte Angaben zum Ereignis. Dieses Vorgehen kollidiert mit dem Wunsch der Opfer nicht über das Geschehene sprechen, bzw. nicht im Detail darüber Auskunft geben zu müssen, um nicht erneut traumatisiert zu werden. Auch die Beurteilung der adäquaten Kausalität zwischen psychischen Beeinträchtigungen und der Straftat führt immer wieder zu schwierigen Fragestellungen. Im Workshop wird den Teilnehmenden aufgezeigt, welche Voraussetzungen für welche Art von Hilfe erfüllt sein müssen. Gemeinsam soll diskutiert werden, was dies für das Opfer bedeutet.
Gegenübertragung in der Traumatherapie. Von der Theorie zur Praxis
Raum: Newton 1008
Seit Ferenczi weiß man, dass die Gegenübertragung, und wie sie vom Therapeuten verstanden und genutzt wird, einen wichtigen Teil der Traumatherapie darstellt. Heutzutage wird Gegenübertragung im Kontext der Psychotherapie schwer traumatisierter Menschen oft erwähnt, jedoch selten konkret und vertieft angegangen. Es könnten Schamgefühle ein möglicher Grund dafür sein, dass die Psychotherapeut*innen sich scheuen, über ihre Gegenübertragung zu sprechen. In der Tat, Gegenübertragung hat mit der eigenen Person der Therapeut*innen zu tun. Es handelt sich dabei um ihre intimen und persönlichen Gedanken, Emotionen, Körpergefühle, Fantasien, Träume, aber auch um theoretische Überlegungen. All diese Elemente haben vielleicht sogar vorwiegend mit der Person der Therapeut*innen zu tun. Reinszenierung kann dabei ein Thema, sein, aber wohl kaum ausschliesslich. Die Geschichte der Patient*innen können traumatische Ereignisse sowie Bindungstraumatas der Therapeu*innen aktivieren. Die Therapeut*innen werden diese berücksichtigen, bewusst oder unbewusst, konstruktiv oder nicht, was einen Einfluss auf die Therapie haben wird. In dieser Präsentation werden zuerst kurz theoretische Grundlagen der Gegenübertragung nach Pearlman & Saakvitne (Trauma and the therapist, 1995) präsentiert. Danach wird anhand von klinischen Fällen die therapeutische Nutzung der Gegenübertragung in der klinischen Arbeit illustriert und mögliche darauf basierende Interventionen vorschlagen, die in der Therapie Blockaden lösen können. Die Präsentation hat das Ziel, offen über die Gegenübertragung zu sprechen, eine Tatsache, die nicht oft geschieht.
Parallel-Veranstaltungen 4
Glaubhaftigkeitsbegutachtung unter Berücksichtigung von Borderline-Störung und Depression von Explorand:innen
Raum: Auditorium
Es geht um die Frage nach der Erlebnisfundierung einer spezifischen Aussage zu einem konkreten rechtserheblichen Geschehen im Mittelpunkt der aussagepsychologischen Prüfung“ zu stellen, dabei aber „in der Zeugenpersönlichkeit gelegene, etwa störungsspezifische Besonderheiten und Defizite, die Auswirkungen auf die an eine Zeugenrolle geknüpften Erfordernisse haben“ systematisch in die Prüfung miteinzuziehen.

Prof. Dr. phil. Henriette Haas
Titularprofessorin der Universität Zürich
Praxis in Montreux und Zürich.
"Schon zweimal in der Klinik und immer noch nicht gesund?!?" Auswirkungen, Verlauf und stationäre Behandlung von Traumafolgestörungen
Raum: Cobol
Psychische Folgen von Gewalt, Unfällen und Katastrophen zeigen - bei allen Gemeinsamkeiten - aber auch grosse individuelle Unterschiede hinsichtlich Ausprägung, Verlauf und Therapie. Die Art und der Zeitpunkt der Traumatisierung sind hierbei ebenso wichtige Einflussfaktoren wie vorausgegangene und nachfolgende Erfahrungen der Opfer. Sie haben nicht nur Auswirkungen auf die Schwere der Symptomatik, sondern auch auf die Fähigkeit, die jeweiligen Symptome selbstwirksam kontrollieren und sich vor ungewollten Wiedererinnerungen bzw den damit häufig verbundenen emotionalen Überforderungen schützen zu können. Nicht zuletzt hängt es auch von dieser Fähigkeit ab, wieviel Erinnerung an das Trauma das Opfer selbst zulassen und wieviel Erinnerung ihm von Dritten zugemutet werden kann. Die Behandlung einer Traumafolgestörung hat daher im Wesentlichen auch die Förderung dieser Fähigkeit zur verbesserten Selbstwirksamkeit zum Ziel. Dieser Kongressbeitrag richtet sich in erster Linie an Interessierte, die selbst nicht therapeutisch tätig sind, aber beispielsweise im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben oder ihres sozialen Engagements Kontakt zu Menschen mit Traumafolgestörungen haben. Neben einer Übersicht über die Symptome, die innerseelischen und zwischenmenschlichen Auswirkungen einer Traumafolgestörung werden Verlauf und Grundprinzipien einer Traumatherapie am Beispiel einer stationären Behandlung erläutert.

Dr. med. Roland Stehr
Oberarzt Psychotherapiestation
St. Gallische Psychiatrie-Dienste Region Süd
Evidenzbasierte Methoden der Traumatherapie im Kindes- und Jugendalter
Raum: Fortran
Evidenzbasierte Methoden der Traumatherapie im Kindes- und Jugendalter In diesem Referat wird nach einer kurzen Einführung zur Klassifikation von Trauma¬folgestörungen gemäss DSM-5 und ICD-11, die aktuelle Evidenzlage in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen präsentiert. Dabei wird Bezug auf die in jüngster Zeit publizierten deutschen und internationalen Leitlinien zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungs¬störung genommen (S3-Leitlinien der AWMF, 2019; ISTSS, 2019; NICE, 2018). Diese em¬pfehlen einheitlich trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapieverfahren als erste Wahl in der Behandlung. Bezüglich EMDR ist die Forschungslage weniger klar, was dazu führt, dass dieses Verfahren aktuell nicht in allen Leitlinien empfohlen wird. Das Referat schliesst nach einer Darstellung der Limitationen der aktuellen Forschungslage (z.B. in Bezug auf komplexe Traumafolgestörungen und in Bezug auf Störungen bei sehr jungen Kindern) mit dem Versuch, die generischen, verfahrensübergreifenden Aspekte der Therapie von Trauma¬folge¬störungen bei Kindern und Jugendlichen darzustellen.

Prof. Dr. Markus Landolt
Ordinarius für Gesundheitspsychologie
des Kindes- und Jugendalters
an der Universität Zürich
Leitender
Psychologe am
Universitäts-Kinderspital Zürich
EMDR in der Praxis
Raum: Newton 1011
Am Beispiel einer 63-jährigen Pflegefachkraft, die auf ihrer Arbeit in der Psychiatrie einem tätlichem Übergriff ausgesetzt war und nachfolgend unter Schlafstörungen, Konzentrationseinschränkungen, vermehrter Schreckhaftigkeit, psychovegetativer Unruhe sowie ausgeprägten Vermeidungsverhalten litt, wird die Wirksamkeit EMDR-therapeutischer Interventionen dargestellt. Es werden die verschiedenen Phasen der traumafokussierten Intervention vorgestellt und aufgezeigt, dass es mit Hilfe von EMDR gelang, Erinnerungen an den Übergriff zu verarbeiten und auf diese Weise zu dem Gefühl zu gelangen, dass die Belastung abgeschlossen ist und sie wieder Kontrolle über ihr Leben hat. Sie konnte sie ihre Tätigkeit als Pflegefachkraft wieder aufnehmen.

Die neue, unabhängige Meldestelle gegen Pädokriminalität im Netz und die politischen und rechtlichen Hintergründe in der Bekämpfung von organisierter sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen
Raum: Newton 1010
Der Workshop knüpft am Plenarvortrag 1 von Herrn Michael Esser zur organisierten sexualisierten Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach an und zeigt auf, welche rechtlichen und politischen Möglichkeiten auf nationaler Ebene bestehen, um der (organisierten) sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zu begegnen. Aktuelle politische Forderungen werden eingeordnet und jüngere Entwicklungen (etwa die Änderungen an Strafprozessordnung und Sexualstrafrecht) aufgezeigt. Es wird dargelegt, welche Chancen und Risiken es bei der Umsetzung gibt und wo der dringendste Nachholbedarf besteht. Anschliessend werden Ziele, Angebot und Funktionsweise der neuen, privaten «Meldestelle gegen Pädokriminalität im Netz» vorgestellt. Sie ist ein Beispiel für zivilgesellschaftliche Bemühungen, im vorhandenen rechtlichen und politischen Umfeld zum Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt beizutragen. Nicht zuletzt bietet der Workshop den Teilnehmenden auch die Möglichkeit, in einer Diskussions- und Austauschrunde die Meldestelle oder die rechtlichen und politischen Aspekte zu diskutieren.

Niklaus Bieri
Leiter Politik und Public Affairs
Kinderschutz Schweiz

Liliane Minder
Projektleiterin Meldestelle
Kinderschutz Schweiz

Do’s and Dont’s im Paragraphendschungel oder eine kurze Anleitung zum Verfassen von Therapieberichten für Gerichtszwecke
Raum: Newton 1012
Ärzt*innen und Therapeut*innen, die mit Opfern von Straftaten arbeiten, werden oftmals gebeten, einen schriftlichen Bericht über den Therapieverlauf ihrer Klient*innen zu erstellen. Meist verbunden mit dem Hinweis, dass dieser für den Gerichtsgebrauch geeignet sein sollte. Doch was ist damit genau gemeint und was wird erwartet? Muss/darf ich einen solchen Bericht verfassen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen? Was gilt es zu beachten? Was gehört in ein solches Dokument, das einem Gericht im Rahmen eines Straf- oder Zivilprozesses vorgelegt wird, und was nicht? Wo liegen allenfalls Fallstricke? Wem dient ein solcher Bericht und wer bekommt ihn zu lesen? Und – last but not least – wer bezahlt meinen Aufwand? Fragen über Fragen…
In diesem interaktiven Workshops unter Leitung einer erfahrenen Opferanwältin versuchen wir, ein wenig Licht in den Paragraphendschungel zu bringen und erarbeiten gemeinsam Orientierungslinien, die den Verfasser*innen von Therapieberichten die Arbeit erleichtern und Opfervertreter*innen ermöglichen, sachdienliche gerichtsverwertbare Berichte beizubringen.
Der Workshop richtet sich in erster Linie an medizinisch und therapeutisch tätige Personen, Opfervertreter*innen und Angehörige der Strafverfolgungsbehörden, steht aber selbstverständlich allen Interessierten offen.

Denise Kramer-Oswald, lic. iur.
Rechtsanwältin
Kramer & Kramer, Rechtsanwälte und Mediatoren
Assistenzhunde für Menschen mit Traumafolgestörungen: Indikation, Arbeitsweise, Finanzierung, Grenzen
Raum: Newton 1008
Ein Assistenzhund begleitet seinen Assistenznehmer rund um die Uhr zu Hause, aber auch hinaus in den öffentlichen und behördlichen Raum. Er vermittelt vielen Betroffenen das Gefühl von mehr Sicherheit in Situationen, welche für den Assistenznehmer zunächst nicht bewältigbar erscheinen und fördert somit das Erweitern des eigenen „Reviers". Die vierbeinigen Begleiter sind je nach persönlichen Bedürfnissen trainierbar, kennen die individuelle Körpersprache „ihres “ Menschen und lernen in der Ausbildung rechtzeitig vor beginnenden Anspannungskrisen zu warnen, aus dissoziativen Zuständen aktiv zurück zu holen, „ihrem “ Menschen bei Bedarf das etablierte Notfallkit zu bringen, an die Einnahme von Medikamenten zu erinnern, Räume vor dem Betreten seines Menschen abzusuchen, nachts bei Albträumen Licht aufzudrehen, im Notfall die Hilfe anderer Menschen zu aktivieren und vieles mehr. Sie verschaffen „ihren“ Menschen auch in Menschenmengen, in ÖV oder beim Einkaufen mehr Raum und Abstand, indem sie „blocken“ und Körpersprache zum Wohl ihres Menschen aktiv einsetzen. Da „PTBS-Assistenzhunde“ ganz offiziell auch auf Behördengängen, zu Arztterminen und sonstigen Herausforderungen begleiten dürfen, sind sie verlässliche Begleiter auf dem Weg zurück in ein selbstständigeres Leben.
Im Vortrag werden die Ausbildungsoptionen zum „PTBS-Assistenzhund“, sowie die ganz konkrete Arbeitsweise der Assistenzhunde praxisnah mittels Live-Demonstrationen und/oder Videomitschnitten dargelegt. Weiters ist es Ziel, notwendige Voraussetzungen bei den Assistenznehmern, sowie Bedürfnisse und Grenzen der Assistenzhunde in Ergänzung zur interdisziplinären Therapie und Begleitung zu beleuchten.

Susan Schaffner
Assistenzhundezentrum Schweiz

Conny Ganter
Assistenzhundezentrum Schweiz
Apéro - in der Industrieausstellung
Apéro zum Abschluss der Konferenz







